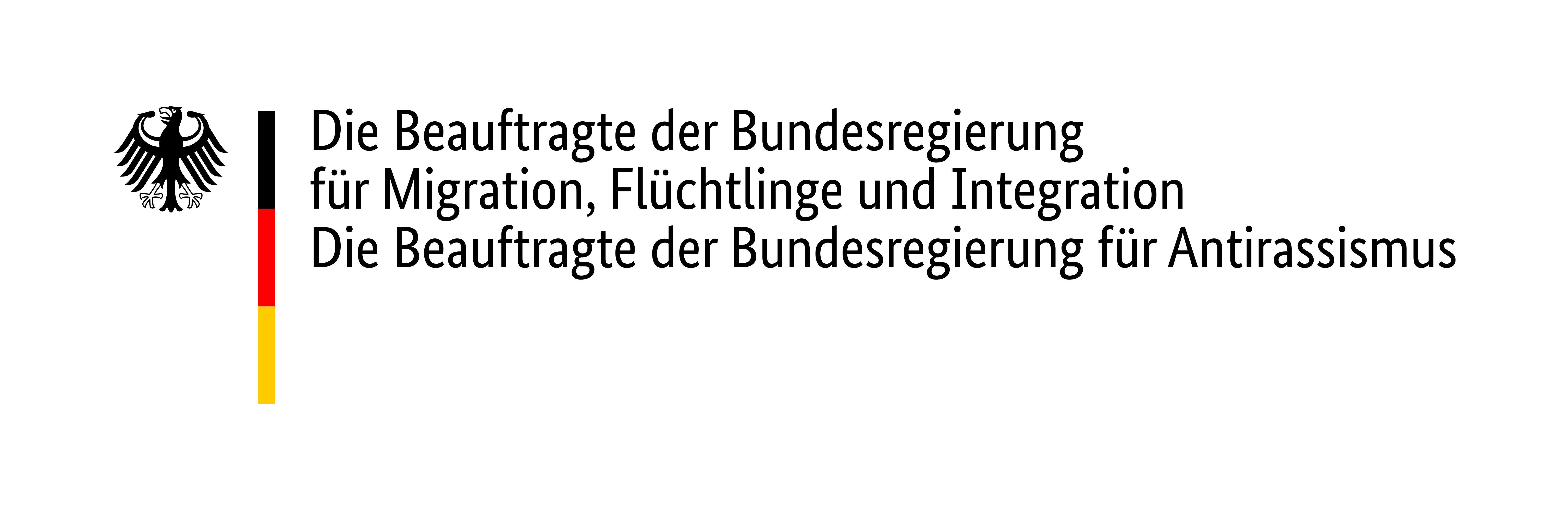Von Rassismus-Betroffene aus Saarbrücken berichten in diesem Beitrag über den Alltagsrassismus, den sie in ihrer Stadt erleben. Einige leben seit Jahren in Saarbrücken, einige sind 2015/2016 gekommen, andere in Saarbrücken aufgewachsen – einer Stadt mit fast 30.000 Menschen mit Migrationsgeschichte. Gemeinsam haben sie dies: Sie werden als Nicht-Deutsche wahrgenommen und immer wieder ausgegrenzt – unabhängig von Geburtsort, Staatsbürgerschaft oder gesellschaftlichen Engagement.
„Es ist bei allen diesen Fällen für uns schwierig, Rassismus zu beweisen“, sagt Lillian Petry, samo.fa- Koordinatorin vom Saarbrücker Haus Afrika. „Es gibt oft keine Zeugen, viel spielt sich auch über Blicke oder Ausschluss von sozialen Aktivitäten oder Besprechungen bei der Arbeit ab.“ Und: „Es ist leider Alltag für viele Menschen, dass sie aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft ausgegrenzt werden.“ Betroffene seien zudem nicht immer bereit, etwas dagegen zu tun. Auch hier berichten sie anonym, unter anderem um ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden.
Auch auf Geflüchtete aus dem samo.fa-Projekt wirken diese Ausgrenzungen inzwischen als Hürde beim wirklichen Ankommen in der Gesellschaft. Denn: „In Sprachkursen oder Beratungssituationen waren sie während der ersten Zeit nach ihrer Flucht sozusagen in einem Schutzraum und sowieso in einer Ausnahmesituation“, sagt Lillian Petry. In Saarbrücken gab es wie in vielen Städten in 2015 viel spontane Hilfsbereitschaft – „vor allem in Form von Sachspenden und Geschenken, die aber nicht immer zu den Bedürfnissen passten: Der Wert von deutschem Porzellan und anderen Einrichtungsgegenständen erschließt sich nicht jedem einfach so, das hat manche Spender beleidigt.“ Es habe auch 2015 schon Sätze gegeben wie „Dann geh doch zurück nach Syrien“, erzählt die Koordinatorin. Allerdings sei das nicht per se Rassismus. „Manchmal sind solche Fragen oder Bemerkungen eben keine Einstellungen, sondern Missverständnisse, die sich durch Nachfragen und Kontakt auflösen“. Wenn Kinder fragten, ob das Essen halal sei, fänden das einige Bürger*innen unhöflich. „Wer dann nachfragt und eine Antwort bekommt, verändert aber meistens die Perspektive und lernt Respekt.“
Für die Geflüchteten im vierten Jahr beginnt aber jetzt eine andere Phase, was das Erleben von Rassismus angeht: Sie bewegen sich weniger in Schutzräumen, sondern auf dem Arbeitsmarkt, im allgemeinen Bildungssystem, in ihrer Nachbarschaft – die Ausnahmesituation endet, der Alltag beginnt. Und in ihm gibt es Ausschlussmechanismen. „Rassismus ist eine Wand, vor die Menschen laufen und die sie in ihrer Entwicklung bremst.“
H.B., Ärztin:
„Rassismus erlebe ich, wenn ich meinen Arztkittel anhabe und Patienten mich trotzdem Krankenschwester nennen. Oder sogar die anderen Ärzte fragen, ob ich Blut abnehmen kann. Ich bin schwarz und habe ein Kopftuch: Wie könnte ich da Medizin studiert haben?!
R.: Lehrerin
„Ich bin von Beruf Lehrerin mit 14 Jahren Erfahrung. Mangels Anerkennung der in meinem Herkunftsland erworbenen Berufsausbildung und -erfahrung arbeite ich als Betreuerin im Ganztagsbereich der Schule. Meine anderen Kollegen mobben mich: Informationen kommen nicht bei mir an, Gespräche verstummen, wenn ich in den Raum komme. Ich gehöre nicht dazu. Das wird mir jeden Tag gezeigt. Ich kann nicht dagegen tun, weil ich Angst habe, meinen Job zu verlieren. Alle gehen früh nach Hause und ich bleibe jeden Tag länger, weil ich aus Druck und Angst heraus, mehr leisten muss, damit es nicht noch schlimmer wird.
Y.K., Schülerin
Rassismus erlebe ich, wenn ich spät bin, wie alle anderen auch, und die Lehrerin meint, für mich wäre es normal. Ich bin hier in Deutschland geboren, werde aber immer mit “afrikanisch” verbunden.
W., Ärztin
„Patienten fragen mich, ob ich eine richtige Ärztin bin, weil ich schwarz bin.“
R.O., Fußballspieler:
„Rassismus fühle ich im Alltag, wenn ich Sprüche höre auf dem Platz wie „Affe“, „Baumwollpflücker“ oder „Schwarze beim Fußball“, wenn ich einen Fehler gemacht habe.“
A.M., studierter Informatiker mit Aufenthaltstitel:
„In einer Maßnahme hat ein Teilnehmer gesagt, dass ich nach afrikanischen Gerichten rieche.“
L.K., Bürokauffrau und Kinderbetreuerin, verheiratet mit einem Deutschen/einer Deutschen:
„Rassismus ist für mich, wenn meine Schwiegermutter fragt, ob es in Afrika es auch Brot mit Butter und Marmelade gibt.“
P.B., Pastor und Lagerist:
„Ich bekomme bei der Arbeit immer die Aufgaben, die die anderen nicht machen wollen.“
V.K., Ehrenamtliche bei Haus Afrika:
„Im Schwimmbad gehen Leute weg, wenn wir mit unserer Kindergruppe mit vielen Flüchtlingskindern kommen.“
Olli, Altenpflegerin
„Meine schwarze Hautfarbe wird mit HIV-Infektion gleichgesetzt.“